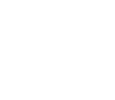Prüfungsthemen: Zivilrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
8,0 |
|
Endnote |
9,0 |
|
Endnote 1. Examen |
9,15 |
Zur Sache:
Prüfungsthemen: BGB AT; Schuldrecht BT
Paragraphen: §323 BGB
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort, Fragestellung klar
Prüfungsgespräch:
Zu Beginn teilte die Prüferin uns einen 2-seitigen Sachverhalt aus, welchen sie uns – und den knapp 20 Zuschauer*innen – vorlas. In dem Sachverhalt ging es zusammengefasst um Folgendes: K (Käufer) erwirbt für sein Unternehmen ein Auto von dem Porsche-Vertriebshändler B. Man einigt sich auf ein Lieferdatum im „2./3. Quartal des Jahres 2023 (?!)“. Individualvertraglich vereinbaren die beiden noch, dass ein Verzug des B nur dann eintritt, wenn 1) K ihn anmahnt und 2) 2 weitere Quartale (oder Monate?!) verstrichen sind. Zudem ist eine einfache Schriftformklausel im Vertrag enthalten. Ende Mai 2023 informiert der B den K per WhatsApp darüber, dass sich die Lieferung des Autos verzögern würde, woraufhin K mit einer Emoji („Ärgerliches Grinsen“) reagiert und schreibt „Ups…trotzdem danke für die Info“. Mitte Juni schreibt B dem K, die Lieferung verzögere sich auf das 1. Quartal des Jahres 2024, woraufhin K ein „Daumen hoch“-Emoji schickt. B meldet sich dann wieder uns sagt, das Auto sei wegen eines Fehlers in der Produktion aktuell nicht lieferbar, da es einen serienmäßigen Fehler gebe, der zunächst behoben werden müsse. Daraufhin tritt B vom Vertrag zurück und verlangt seine Anzahlung zurück sowie 9% Zinsen. B verlangt Zahlung Zug um Zug ggn Übereignung des PKW. Zunächst fragte die Prüferin uns, wie es möglich sei, dass K den PKW „für sich“ erworben habe, aber dennoch gewerblich aufgetreten sei -> Eingetragener Kaufmann. Dann fragte sie, was wir nun prüfen würden. Es stand nicht im Text, aber wir sollten Rechtsanwältin des K sein. Daraufhin prüften wir den Rücktritt. In erster Linie ging es darum, ob beziehungsweise wann Fälligkeit eingetreten war und ob diese durch die ausgetauschten Textnachrichten nachträglich (konkludent) geändert wurde. Wir diskutierten, ob der ersten Emoji eine Annahme eines Angebotes auf Abänderung der Fälligkeit war. -> §§ 133, 157 BGB: Auszulegen nach dem Empfängerhorizont (Wie durfte B diese Nachricht verstehen?) -> Die Prüferin fragte uns gezielt nach Argumenten gegen die Annahme eines Angebotes – Emojis werden unterschiedlich interpretiert, keine universelle Geltung, nicht eindeutig -> … sowie nach Argumenten für die Annahme eines Angebotes – „TROTZDEM“ danke impliziert eine grundsätzliche Zustimmung Sie teilte uns mit, dass es noch nicht höchstrichterlich entschieden sei und fragte uns, was wir zu dem „Daumen-hoch“-Emoji als Annahme sagen würden -> Universelle Geltung als Annahme Dann fragte uns die Prüferin, warum es hier überhaupt eine Abänderung geben könne, da die Parteien ja doch eine Schriftformklausel vereinbart hätten. -> lediglich einfache Schriftformklausel, keine doppelte Dann hielten wir uns sehr lange an den §§ 126, 127 BGB auf und diskutierten, ob eine Textnachricht unter „telekommunikative Übermittlung“ im Sinne des § 127 II BGB fällt, was dafür und was dagegensprechen könnte. Hier wollte sie insbesondere den Sinn und Zweck des § 126 BGB hören. – Fixierung, Privatautonomie, Parteivereinbarung, Bindungswillen, Rechtsfolgen vor Augen führen, Warnfunktion Gegen eine Einhaltung des § 127 II BGB: – keine Fixierung, fälschungsanfällig, kann gelöscht werden, kann bearbeitet werden Für eine Einhaltung des § 127 II BGB: – kann nur begrenzt bearbeitet werden, Löschung nur, wenn beide Parteien die Nachricht löschen, Back up aus der Cloud, Entwicklung, Zeitalter, als das BGB entwickelt wurde gab es noch keine Smart devices Abschließend sprachen wir noch darüber, wie es denn sein kann, dass der K 9% Zinsen fordert. -> § 288 II BGB Bekommt er sie? -> Nein, ist keine Entgeltforderung Dann sprachen wir noch darüber, was in eine Klage gehört und wie der Richter/die Richterin verfährt, wenn die Klage bei Gericht eingeht. Die Prüferin fragte uns auch, bei welchem Gericht die Klage einzureichen sei und wollte hier insbesondere wissen, was der Unterscheid zwischen § 17 ZPO und § 21 ZPO ist. -> § 17 ZPO: Hauptsitz -> § 21 ZPO: Zweigniederlassungen
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Hessen vom Januar 2025. Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.